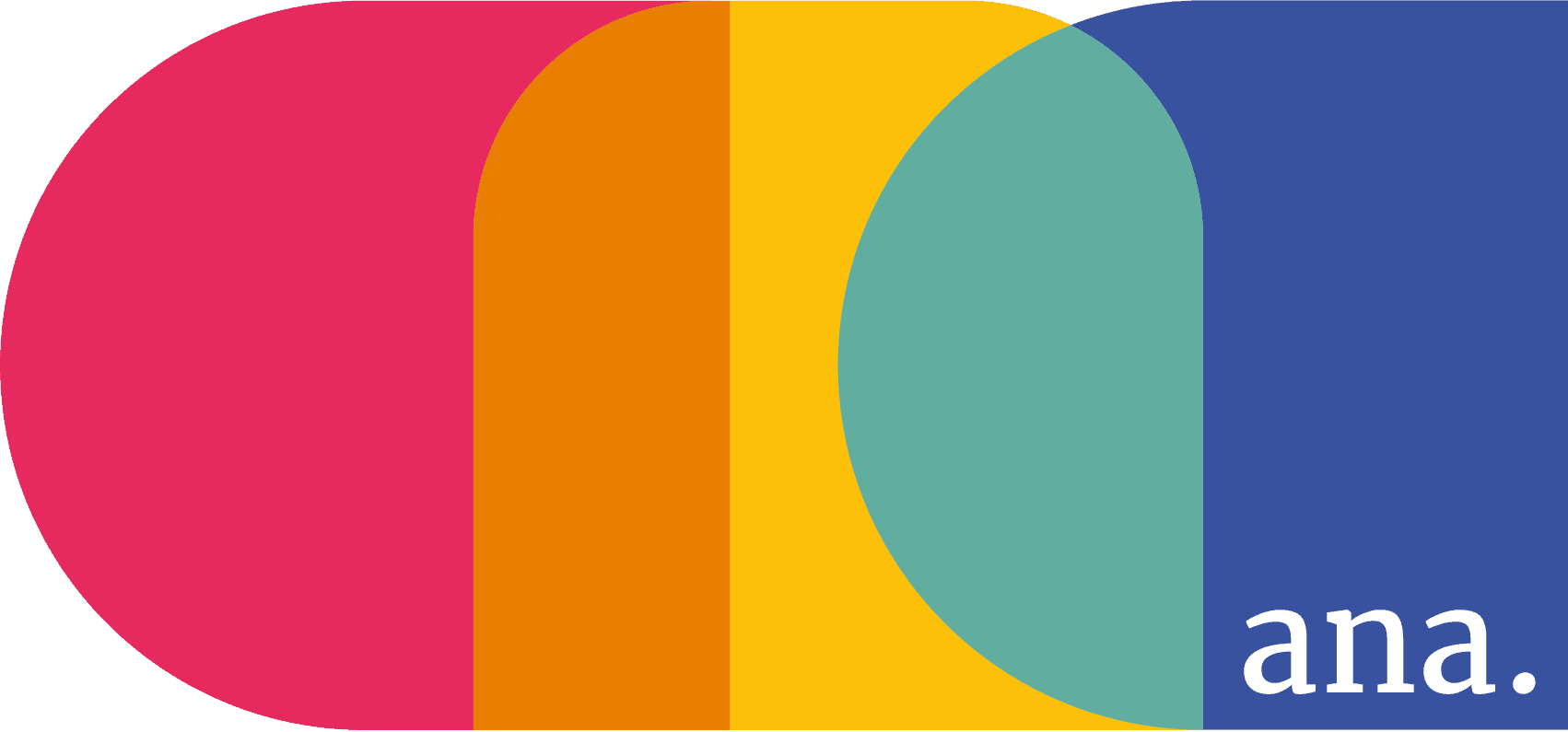PERSPEKTIVWECHSEL ist ein fortlaufendes Frage-Antwort-Format, in dem sich zwei Protagonisten im Rahmen eines Themenkomplexes alles fragen dürfen, was für sie eine wichtige Rolle spielt. Das ana magazin dient dabei als Plattform und Moderatorin, aber nicht als Fragestellerin. Die Fragen kommen vielmehr aus der Mitte der Gesellschaft, präsentiert durch die zwei Protagonisten, zwischen denen das Fragerecht hin und her wechselt.* Ziel ist, den in der Gesellschaft geführten Diskurs möglichst authentisch abzubilden, ohne dass dieser von der Haltung des ana magazins vorgegeben wird. Erstes Thema des neuen Formats: Die Klimakrise.
Hier geht es direkt zur Diskussion:
Vorbemerkungen
In einer Welt, die sich zunehmend in der eigenen sozialen und kulturellen Blase abspielt, in der die eigene Meinung immer öfter als Mehrheitsmeinung wahrgenommen wird, soll das Format PERSPEKTIVWECHSEL eine Einladung sein. Eine Einladung zum Hinterfragen und Verstehen von anderen Standpunkten, aber auch zum Andersdenken oder Widersprechen. PERSPEKTIVWECHSEL möchte die Möglichkeit bieten, sich nicht nur mit strittigen gesellschaftspolitischen Themen auseinanderzusetzen, sondern sich für andere Seiten des demokratischen Meinungsspektrums zu öffnen. Das Vorhandensein einer anderen Meinung soll als Chance zum Austausch und Gewinn für das gesellschaftliche Miteinander gesehen werden und nicht als Angriff auf die Demokratie oder eigene Werte. Ausgehend von den gestellten Fragen der Protagonisten möchte PERSPEKTIVWECHSEL Anregung zum Selberdenken und zum Überprüfen der eigenen Meinung geben: Wie ist die eigene Haltung zu der Frage? Könnte der andere Recht haben? Oder bleibt am Ende des Prozesses die eigene Meinung alternativlos? Auch das ist möglich!
PERSPEKTIVWECHSEL ist ein dynamisches Format. Es sollen nicht zwei Personen in einem Monolog die eigene Haltung zu einem Thema oder einer Frage wiedergeben – starr und ohne Kenntnis der Argumente der anderen Person. Vielmehr leben Diskurs und Demokratie vom aufeinander Eingehen. In diesem Sinne begnügt sich das Format nicht mit dem bloßen Frage-Antwort-Rhythmus, sondern gibt der fragenden sowie der antwortenden Person die Möglichkeit der Erwiderung. Die Gleichung lautet also: Eine Frage, drei Antworten. Somit soll ein Raum des Dialogs entstehen.
Während andere Formate dem beschränkenden Faktor erlegen sind, nur das Abbilden zu können, was im Zeitpunkt der Veröffentlichung von den Beteiligten gesagt, geschrieben oder gedacht wurde, entzieht sich PERSPEKTIVWECHSEL dieser Beschränkung. Indem das Format fortlaufend ist, wird gewährleistet, dass der stattfindende Diskurs auch aktualitätsbezogene Entwicklungen aufgreifen kann. Gleichzeitig bietet es den Protagonisten die Möglichkeit, die eigene Meinung zu überdenken und diese im Verlauf des Austauschs zu ändern oder aber zu verfestigen.
Los geht es am 29. Mai 2023 mit unserem ersten Perspektivwechsel zur Klimakrise. Daran anschließend erfolgt die Veröffentlichung der Frage-Antwort-Wechsel im Zwei-Wochen-Rhythmus. Während auf dem Instagram-Kanal ana__magazin die Antworten in Kurzform veröffentlicht werden, erscheinen in diesem fortlaufend aktualisierten Beitrag die Volltext-Versionen.
Tobias Krause. Leipzig, Mai 2023.
PERSPEKTIVWECHSEL | Klimakrise
In der ersten Ausgabe von PERSPEKTIVWECHSEL widmen wir uns der Klimakrise. Sollte sich die Einzelperson in Verzicht üben? Muss die Politik regulierend eingreifen? Sind erneuerbare Energien das Allheilmittel? Und wie ist die Haltung zu den Aktionen der Letzten Generation? Fragen, die die Gesellschaft beschäftigen und auf die bislang kein Konsens gefunden wurde. Es sind aber Fragen, deren Beantwortung sich auf das gesellschaftliche Miteinander auswirkt und die das Potenzial haben, ganze Gesellschaften zu spalten.
Antwort von Malin F. Kollat**:
Hinter dem Wort “Klimakrise” verbirgt sich der Zusammenbruch der lebenserhaltenden Systeme um uns herum. Das globale Ökosystem wurde in den letzten 400, insbesondere den letzten 70 Jahren von Menschen übernommen, seine Grenzen massiv überschritten und nun erleben wir seinen Zusammenbruch, sein Absterben, seinen Tod.
Unsere alltägliche Art der Lebensführung, geprägt von beispiellosem Energieverbrauch (80% fossil), zerstört die Voraussetzungen für ihren eigenen Fortbestand. Das ist der zentrale Widerspruch, in dem wir leben. Der Aufrichtigkeit halber sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass die Widersprüche entlang der gesellschaftlichen Hierarchie stark exponentiell, nach oben hin bis ins Obszöne, zunehmen.
Wie mit allen Widersprüchen zwischen unseren Wertvorstellungen und unserem Handeln können wir auch mit dem, dass die Mittel, welche wir zur Verfügung haben, die Voraussetzungen für unsere sichere Zukunft zerstören, prinzipiell auf drei Arten umgehen.
- Wir lösen den Widerspruch auf, indem wir uns (und anderen) in einem kreativen Akt eine Geschichte erzählen, in der er nicht vorkommt oder nichts mit uns zu tun hat. De facto leugnen oder verdrängen wir den Widerspruch. Aus dieser gewählten Bewusstlosigkeit erschaffen wir den Widerspruch stets aufs Neue und bleiben Ursache des finalen Sterbens um uns herum.
- Wir sehen den Widerspruch, erkennen ihn an und halten ihn aus. Dieser Dreischritt ist sicher notwendig, da wir nicht direkt alle Teilwidersprüche auflösen können. Denn einige dafür notwendige Entscheidungen werden auf Ebenen getroffen, auf die wir keinen Zugriff oder falls doch, nur sehr indirekt Einfluss haben. Die Fähigkeit, sich als hilflos zu erleben und ein Selbstbild auszuhalten, in dem wir Opfer von Umständen sind, aber auch von Entscheidungen anderer, die Macht über uns ausüben, ist die Voraussetzung.
- Wir richten uns danach aus, den Widerspruch aufzulösen, unser Handeln und unser Wissen in Einklang zu bringen. Die Mythen, die in unserer Gesellschaft bisher als ordnende Orientierung gedient haben, werden aus dieser Haltung heraus als solche erkennbar und verlieren ihre Glaubwürdigkeit. In einer Gesellschaft, die verdrängt und Verantwortung von sich weist, führt eine innere Haltung, die die Wirklichkeit anerkennt und bestrebt ist, die eigene Würde zu bewahren, in den Widerstand gegen eine todbringende Normalität.
Wer in einer Gesellschaft, die verdrängt und Verantwortung von sich weist, sich selbst eben dieser verdrängten Wirklichkeit und Verantwortung aussetzt, erkennt, wie würdelos wir uns den zukünftig lebenden Menschen und damit auch uns selbst gegenüber verhalten. Im Widerstand gegen diese todbringende Normalität finden wir zu uns selbst – bewahren unsere Würde. Widerstand zu leisten ist das lebensbejahendste das wir tun können.
Ich persönlich strebe nach der dritten Möglichkeit.
Antwort von Andre M. Schippko***:
Der Klimawandel ist real. Er ist zum größten Teil menschengemacht und wird kaum mehr aufzuhalten sein. Neben den eindeutigen wissenschaftlichen Messungen sind die Veränderungen für uns alle im Alltag spürbar. Ich mache dies insbesondere an drei Bereichen fest:
- Weite Teile der Wälder Deutschlands befinden sich in einem sehr schlechten Zustand, der maßgeblich durch die langen Dürreperioden der letzten Jahre herbeigeführt wurde. Bemerkbar wird dieses Problem vor allem im Bereich der ausgedünnten Baumkronen, die für alle sichtbar sind. Altbestände von Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen sind nicht in der Lage, nachträglich tiefer zu wurzeln, sodass es in einigen Jahren zu einem enormen Waldsterben kommen wird. Angeheizt wird das ganze noch durch eine stärker werdende Ausbreitung von Schädlingen (überwiegend des Borkenkäfers), sodass sich die Veränderung in unseren Wäldern noch beschleunigen wird.
- Auch in meiner Freizeit bemerke ich den Wandel der letzten Zeit hautnah. Im kleinen Maßstab betreibe ich ökologischen Ackerbau und erlebe so die Veränderungen, besonders beim Blühverhalten und bei der Fruchtung von Obst- und Gemüsepflanzen, das ein Indikator für einen völlig durcheinander geratenen Zeitablauf der Natur ist. Zusammen mit den immer größer werdenden Trockenschäden wird die Klimaveränderung auch in der veränderten Zusammensetzung der Flora für jeden greifbar – Jahr für Jahr, in einem dynamischen andauernden Prozess.
- Meine Besorgnis gilt neben der Erderwärmung auch der Umweltverschmutzung durch Schwermetalle, die vornehmlich im Bergbau und in der Industrie freigesetzt werden. Anders als die potentiell zukünftigen Methoden im Bereich des Geoengineering wird es hier kaum eine Möglichkeit geben, diese Schäden nachträglich auszubessern.
Die Menschheit wird neue Techniken und Strategien entwickeln müssen, um mit den veränderten Bedingungen umgehen zu können. Der Klimawandel wird von uns allen verlangen, unser Konsumverhalten zu ändern und uns zukünftig mit seinen Folgen in unserem Alltag auseinandersetzen zu müssen.
Trotz all dem befinde ich mich nicht im aktiven Kampf gegen die Klimakrise, da ich in meinem Beruf voll eingebunden bin und Verantwortung für andere Menschen trage, die ich nicht direkt abgeben kann. Dennoch versuche ich, möglichst klimaneutral – heißt ressourcenschonend – zu leben.
Antwort von Malin F. Kollat**:
Eine Gegenfrage – und ein wenig Hintergrund:
Richten sich die Proteste von Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, gegen kranke Menschen? Natürlich nicht! Es ist der Hebel, der Arbeitenden zur Verfügung steht. Das Recht, gegen ungerechte Arbeitsbedingungen wirksam zu protestieren, also zu streiken, musste unter großen Opfern erkämpft werden. Innerhalb der großen und diversen Gruppe von Menschen, die für die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen, das heißt für unser aller Überleben, tätig sind, gibt es einen kleinen aber wachsenden Teil, der das auf eine Art macht, die sich nicht ignorieren lässt.
Wenn wir als Weltgesellschaft von dem Pfad abkommen wollen, auf dem wir sind, dann müssen wir unseren Fokus, die Aufmerksamkeit unserer Gesellschaft, darauf richten und sie dann auch aufrechterhalten. Die Erfahrung und die Theorie politischer Praxis sagen uns, dass alles, was an Protest ignoriert werden kann, auch ignoriert werden wird. Bei der größten Katastrophe in der Geschichte der Menschheit wird diese Ignoranz, sollte sie weiter bestehen, zu einer unvorstellbaren, nie dagewesenen Menge an Leid führen. Das zu verhindern, es zumindest zu versuchen, ist unsere Pflicht.
Erwiderung von Andre M. Schippko***:
Bei einem Streik von Mitarbeitern aus dem Gesundheitssystem wird stets die Notversorgung aufrechterhalten, sodass die Akzeptanz der Betroffenen in einem gewissen Rahmen gegeben ist. Die Blockadeaktionen der Klimabewegung behindern hingegen pauschal alle Menschen, die sich in diesem Moment im Straßenverkehr bewegen – unabhängig davon, ob sie einen wichtigen Termin wahrnehmen müssen oder nur zum Vergnügen unterwegs sind. Sollten sich die Blockaden nicht vielmehr gezielt gegen die Hauptverursacher richten, deren ökologischer Fußabdruck überproportional größer ist im Vergleich zu dem eines Normalbürgers?
Der Protest lässt sich nicht ignorieren, was durchaus ein wichtiges Merkmal ist. Auf der anderen Seite schürt er jedoch den Hass der Menschen, den sie möglicherweise auf die gesamte Klimabewegung projizieren. Die dadurch hervorgerufene Wut lässt sie die zweifelsohne positiven Absichten der Bewegung aus dem Fokus verlieren, der meist eher auf kurzfristige Ereignisse ausgerichtet ist.
Im Kampf gegen die durch den Klimawandel hervorgerufenen Folgen sind wir auf die aktive Unterstützung möglichst vieler Menschen angewiesen. Nicht nur die politischen Entscheidungsträger entscheiden alleine über die Ergreifung von Gegenmaßnahmen, sondern auch jeder einzelne für sich durch seinen Verbrauch an Ressourcen. Noch können wir einzelne Beeinträchtigungen durch erhöhten Geld- bzw. Arbeitsaufwand kompensieren, sodass sich die Erfüllung vieler dringend benötigter Maßnahmen aufschieben lässt.
Replik von Malin F. Kollat:
Ich hätte auch von Streiks im Flug- oder Bahnverkehr sprechen können, die alle treffen. Der Punkt, dass Handeln dieser Art sich nicht gegen Menschen richtet, ist, denke ich, deutlich geworden und die selbstverständliche, hart erkämpfte Akzeptanz in anderen Kontexten ebenso.
Wenn du mit “Hauptverursacher” die 100 Unternehmen meinst, die für 71% der globalen Emissionen verantwortlich sind, dann kann ich dir berichten, dass Protest vor Werkstoren, selbst das Abdrehen von Sicherheitsventilen an Pipelines, keine mediale Resonanz erzeugt. Wir haben das versucht!
Wenn du darauf abzielst, dass Reichtum mit hohen individuellen Emissionen einhergeht, kann ich dir berichten, dass wir aktuell versuchen, obszöne Verschwendung in den Fokus zu nehmen. Gestern wurde ein Privatflugzeug mit Farbe besprüht.
Es gab und gibt eine sehr erfolgreiche PR-Kampagne von BP, einem der größten fossilen Konzerne der Welt, die den individuellen CO2-Fußabdruck in den Fokus rückt. Das Ziel: die Verantwortung für Emissionen uns als Einzelnen, als Konsumenten, in die Schuhe zu schieben. In deiner Betonung der individuellen Verantwortung sehe ich einen Erfolg dieses Ablenkungsmanövers.
Antwort von Andre M. Schippko***:
Ja, dieser Umstand ist mir durchaus bewusst. Das ist selbstverständlich verwerflich und zeigt, dass die Gier von Menschen dramatische Züge annehmen kann. Dennoch befreit das die restliche Bevölkerung nicht von einer gewissen Mitverantwortung.
Die Darstellung mancher Protestgruppen, dass Erdölfirmen die größten Emittenten für fossile Energieträger seien, stimmt nur auf dem Papier. Die Industrialisierung hat durch die Schaffung von Arbeitsplätzen Wohlstand für viele Familien gebracht und damit automatisch eine Akzeptanz, wenn nicht sogar eine Gleichgültigkeit gegenüber den daraus drohenden Folgen generiert.
Auch ein Leben ohne die direkte Nutzung fossiler Brennstoffe kommt nicht ohne deren indirekte Nutzung aus – beispielsweise bei der Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit im öffentlichen Raum, aber auch für die Versorgung mit lebensnotwendigen Dingen: Wir alle sind Nutzer und Profiteure von fossiler Energie.
Selbstverständlich hat es die Menschheit in diesem Punkt schlicht und ergreifend verschlafen, einen nötigen Wechsel im Lebensstil zu vollführen und neue Technologien für eine nachhaltige Wirtschaft zu entwickeln. Propaganda der Ölkonzerne hin oder her – die Wissenschaft hat die Menschheit rechtzeitig und ausreichend öffentlichkeitswirksam auf die drohenden Gefahren einer zu verschwenderischen Lebensweise aufmerksam gemacht.
Erwiderung von Malin F. Kollat**:
Ich sehe grundsätzlich keinen Weg, sich der Verantwortung zu entledigen. Was es bedeutet, ihr gerecht zu werden, habe ich in Frage 1 angerissen. Ich finde es wichtig, dass wir uns alle diese Frage stellen – immer wieder. Dass Menschen gierig sein können, wissen wir alle. Ist es nicht entscheidend, uns zu fragen, wie die Strukturen aussehen müssen, in denen das nicht zur Vernichtung unserer Gesellschaft(en) führt.
Konstruktive Fragen (wie diese) aufzuwerfen, war meine Absicht. Es irritiert mich, dass ich dich damit zu einer kleinen, quasi mythologischen Erzählung veranlasst habe. Auffallend und bezeichnend ist, dass deine Ausführungen in keine konstruktive Richtung weisen.
Ich habe nach den Firmen als zentrale Akteure der organisierten Klimawandelleugnung gefragt – wobei sich der Diskurs gerade mehr von “denial” zu “delay” entwickelt –, um überhaupt verständlich zu machen, wie bewusst fehlgeleitet und damit dysfunktional unsere Unterhaltungen zu dem Thema sind. Ich wollte über die Netzwerke sprechen, die verhindern, dass auf den absehbaren Verlust unserer Lebensgrundlagen reagiert wird. Sie reichen bis in unsere Bundesregierung hinein. Um die Dimension etwas klarer zu machen: wir wissen von grob 200 Mio US-Dollar im Jahr, die von fossilen Firmen in das Produkt “Zweifel” und Verwirrung gesteckt werden.
Replik von Andre M. Schippko***:
Ich sehe hier überhaupt keine mythologische Erzählung, sondern den Ansatz, eine Erklärung für das Handeln der Menschen in der Vergangenheit zu finden und auch einen vagen Versuch zu unternehmen, die zukünftige Handlungsweise zu prognostizieren.
Du hast im Hinblick auf unser Diskussionsformat eine offene Frage gestellt. Im ersten Moment habe ich diese als nicht konstruktiv empfunden, da sie in meinen Augen die Verantwortung voreilig auf die wenigen Manager und Aktionäre von Unternehmen abschiebt. Selbstverständlich sehe ich, dass die großen Konzerne mit Werbe- und Imagekampagnen stets versucht haben, Einfluss auf uns Menschen zu nehmen. Was ist denn nun die Erkenntnis daraus? Können wir dem Ganzen entkommen?
Ich denke ja: durch Bildung, Überzeugungsarbeit und schlussendlich durch eine auf demokratischem Wege herbeigeführte Entscheidung. Handlungsweisen, die an letzterem vorbeigehen, sind für mich nicht akzeptabel. Sollte die Antwort nein lauten, wäre das wirklich enttäuschend und eine Kapitulation unseres Verstands vor den Kampagnen der großen Konzerne.
Grundsätzlich stimme ich dir zu, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf die Frage lenken sollten, wie unser Zusammenleben künftig aussehen sollte, das zu einer nachhaltigen Aufrechterhaltung unserer Gesellschaft führt. Im ersten Moment habe ich auch nichts gegen die von der Klimabewegung geforderte Räterepublik einzuwenden, solange diese auf einer verfassunggebenden Mehrheit der Bevölkerung beruht. Unser Grundgesetz ist für diese Option offen.
Antwort von Malin F. Kollat**:
Protest und Gesellschaftsordnung sind verschiedene Dinge:
Ziviler Ungehorsam ist ein legitimes Mittel, wenn es der Größe der Ungerechtigkeit, der entgegengetreten wird, angemessen ist und andere Wege ausgeschöpft sind. Dabei ist die Gesellschaftsordnung unerheblich innerhalb derer Menschen zu diesem Mittel greifen. Zugleich ist und war ziviler Ungehorsam Teil der Geschichte – weltweit.
Eine Neuordnung der Gesellschaft nach antidemokratischen Prinzipien ist eine konkrete Gefahr, ausgehend vom rechten Rand des politischen Spektrums. Ich erinnere an Razzien bei bewaffneten und finanziell gut aufgestellten Gruppen mit Putschplänen und Todeslisten. Und es gibt eine ihnen nahestehende Partei mit erschreckenden Umfragewerten, die in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
In der Klimagerechtigkeitsbewegung dagegen gibt es keine Forderung oder gar das Bestreben nach einer Abkehr von der Demokratie. Ganz im Gegenteil: Es werden Gefahren für die Demokratie benannt: die Klimakatastrophe an sich, Lobbyismus oder andere Formen der Beeinflussung durch finanzstarke Player und ihre Interessen. Auch die Forderung nach einem Gesellschaftsrat, wie sie in Teilen der Bewegung, aber auch weit über sie hinaus existiert, ist eine Forderung nach mehr Demokratie. Eine Abkehr vom demokratischen System wäre auch allein schon deswegen abwegig, weil wir unmittelbar handeln müssen und keine Zeit haben, erst neue Institutionen aufzubauen.
Vielmehr nehmen die Menschen in der Klimagerechtigkeitsbewegung ihre Verantwortung als Bürger:innen wahr, in dem sie sichtbar machen, dass unsere Regierung die Verfassung bricht. Auch nehmen sie die Meinung von Wissenschaftler:innen und Militärs auf, die sagen, dass unsere Demokratie kommenden disruptiven Ereignissen nicht standhalten können wird. Sich den Gefahren durch die Klimakatastrophe in den Weg zu stellen, heißt also auch, sich den Gefahren für die Demokratie entgegenzustellen. Wir brauchen unsere Institutionen, um jetzt zu handeln. Mehr Demokratie – Demokratie als niemals abgeschlossener Prozess – ist immer wünschenswert und hilfreich.
Erwiderung von Andre M. Schippko***:
Demokratie ist nach Prof. Münkler das verständigungsbasierte Entscheiden von Fragen, bei denen unterschiedliche Meinungen vorliegen. Die verschiedenen Positionen müssen die Möglichkeit besitzen, ihren Standpunkt deutlich machen zu können – sei es aus der Gesellschaft heraus, sei es von der Politik her.
Der Klimabewegung steht in meinen Augen, in Anbetracht der wissenschaftlichen Erkenntnisse, ein Recht auf zivilen Ungehorsam zu. Selbst die weltumspannende Protestbewegung „Fridays for Future“ hat zu keiner fundamentalen Abkehr des aktuellen Handelns geführt, sodass die vorgesehenen Mittel des Protests ausgeschöpft zu sein scheinen.
Die Gefahr einer antidemokratischen Neuordnung der Gesellschaft sehe ich dennoch von beiden politischen Rändern, die teilweise für sich den Anspruch erheben (oder: in Anspruch nehmen?), sie allein würden den Willen der Bevölkerungsmehrheit verkörpern. Diese vermeintliche Generallegitimation führt zu der Annahme, die Klimabewegung besitze ein absolutes Durchgriffsrecht – was wiederum nach Prof. Münkler einem demokratischen Rechtsstaat nicht mehr genügen würde.
Durch die Einsetzung eines gelosten Gesellschaftsrats möchte die Klimabewegung die politischen Entscheidungen ermöglichen, die für die Einhaltung der Klimaziele von Nöten sind. Die Annahme, dass durch diese Vorgehensweise eine Besserung eintritt, basiert insbesondere darauf, dass eine klimafeindliche Politik nur durch die etablierten Strukturen unseres politischen Systems zustande kommen kann, die sich über den eigentlichen Willen des Volkes hinwegsetzt. Das ist mit Sicherheit ein treibender Faktor, wird aber nicht völlig verschwinden.
Da die Mitglieder des Gesellschaftsrats ausgelost werden sollen, werden sie statistisch eine ähnliche Zusammensetzung aufweisen wie die Bevölkerung. Des Weiteren sollen sie von Expertenräten begleitet werden, denen vor allem Wissenschaftler:innen angehören. Damit ist jedoch nicht automatisch garantiert, dass die Bürgerräte den Beschlussvorlagen folgen werden. Vielmehr würden wohl, wie in der Politik momentan auch, Kompromisse eingegangen werden, die nicht alle den Zielen des Pariser Klimaabkommens genügen – ich vermute, spätestens wenn es um den Erhalt von Arbeitsplätzen oder die Einschränkung im Lebensstandard geht.
Über all dem schwebt selbstverständlich die Möglichkeit, dass der Klimawandel die Lebensgrundlage unserer Gesellschaft zerstört und unsere Diskussion hier überflüssig werden lässt. Ungeachtet dessen sehe ich es trotzdem als der Sache nicht dienlich an, die breite Bevölkerung auf solch tiefgreifende Weise zu stören und damit den Zorn des Volkes heraufzubeschwören und den Fokus auf das eigentliche Thema zu verlieren.
Replik von Malin F. Kollat:
Der Fokus liegt in dieser Intensität nur deshalb auf dem Thema, weil wir unseren Protest unignorierbar in die Öffentlichkeit tragen. Vorher hat das Thema „Klimawandel, Klimakrise: was tun?“ doch gar nicht mehr stattgefunden!
Es ist jetzt soweit, dass Umfragen unter Forscher:innen durchgeführt wurden, die soziale Bewegungen erforschen. Die Experteneinschätzung widerspricht den Meinungen, die in großen Teilen der Presse vertreten und aus Meinungsumfragen abgeleitet werden. Die Ergebnisse bestätigen genau das, was wir in Bezug auf zivilen Ungehorsam sagen: Disruptiver ziviler Ungehorsam ist der wichtigste Faktor beim Erfolg von Bewegungen (nachzulesen hier und hier).
Auch zeigen jüngste wissenschaftliche Untersuchungen sehr deutlich die mangelnde Differenziertheit von Meinungsumfragen über die Klimaproteste auf. Menschen können zwischen Protestform und Inhalt sehr klar unterscheiden und keine der Protestformen senkt die Unterstützung für mehr Klimaschutz. Legitimität ist eine Dimension, die in Meinungsumfragen nicht abgefragt wird. Es zeigt sich hier, dass über 40% die Proteste für legitim halten. Die ideologische Ausrichtung der Befragten geht auch unter: Die politische Rechte und Menschen, die keinen Klimaschutz wollen, lehnen Protestaktionen für mehr Klimaschutz grundsätzlich ab, unabhängig von der Protestform.
Die Denkschablone eines politischen Spektrums mit zwei gleichwertig gefährlichen Rändern, die Du hier benutzt, ist ebenso weit verbreitet wie realitätsfern (nachzulesen beim Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V). Ich schlage vor, dass wir uns hier, wie sonst auch, an Fakten halten. Mehr zum Thema einer Bedrohung von Rechts gibt es in dem NYT-Podcast von Katrin Bennhold DayX oder bei Andreas Kemper, Luis Caballero, Andreas Speit und anderen, oder man kann sich Björn Höcke auch im Original anhören, wenn er unter Pseudonym Landolf Ladig über seine Pläne schreibt.
Ich möchte auch noch auf eine zentrale Verwirrung hinweisen: Die Katastrophe, an deren Anfang wir stehen, ist nur in politischen Kategorien nicht verstehbar. Vergleichen wir die Situation mal mit jener, in der ein Asteroid auf die Erde zurast. Es gibt da keine verschiedenen Positionen, die man sinnvoll formulieren kann. Wir müssen den Asteroiden ablenken! Die anderen Positionen – “der Asteroid ist mir egal” und “Ich will, dass er hier einschlägt” – sind nicht vertretbar, ohne in Widersprüche zu geraten.
Ein Gesellschaftsrat würde sicher nicht alle Probleme lösen, aber es wäre ein Anfang.
Antwort von Andre M. Schippko***:
Die heutige Medienlandschaft präsentiert uns ein facettenreiches Informationsmosaik und gewährt Einblicke in vielfältige Aspekte des Weltgeschehens. Ein vollständiges Ausblenden des Globalen Südens aus der Berichterstattung vermag ich nicht zu erkennen – im Gegenteil: Kaum eine Nation zeigt ein derart lebhaftes Interesse an den Geschehnissen rund um den Globus wie die Deutsche.
Jedoch inmitten dieser Fülle von Themen, begleitet von einem eng getakteten Alltag der Menschen hierzulande, bleibt oft nur begrenzte Zeit für eine umfassende Auseinandersetzung mit sämtlichen weltweiten Angelegenheiten. Durch die Anforderungen eines vollen Arbeitstages und den eventuellen Verpflichtungen gegenüber Mitmenschen wird nicht selten Sport, Unterhaltung und ähnlichen Ablenkungen mehr Bedeutung beigemessen, als es angesichts der globalen Krisen angemessen wäre – ein deutliches Beispiel dafür bot vor Kurzem die schier endlose Berichterstattung über den Transfer eines Fußballspielers im Vergleich zu den anhaltenden weltweiten Herausforderungen. Es ist zu vermuten, dass nicht einmal den Katastrophen direkt vor unserer Haustür genügend Aufmerksamkeit zukommt, wie beispielsweise bei der Flutkatastrophe im Ahrtal.
Aus meiner Perspektive liegt der Schlüssel zu einer gut funktionierenden Gesellschaft nicht unbedingt darin, dass alle Menschen in sämtlichen Belangen umfassend informiert sind und handeln müssen. Die Gesellschaft kann ihren Verpflichtungen auch dadurch gerecht werden, dass sie Fachleute bereitstellt, die sich um die verschiedenen Problematiken kümmern – in diesem Kontext denke ich an Experten für nachhaltige Entwicklung, humanitäre Helfer und Wissenschaftler. Deutschland erreicht bereits seit einigen Jahren die im Rahmen des Entwicklungsausschusses der OWZE vereinbarte Zielmarke von 0,7 % des Bruttonationaleinkommens für öffentliche Entwicklungsleistungen. Im weltweiten Vergleich der geleisteten Entwicklungshilfe nimmt Deutschland eine Spitzenposition ein, die fast ausschließlich im Globalen Süden zum Tragen kommt.
Erwiderung von Malin F. Kollat**:
Von einem “vollständigen Ausblenden des globalen Südens” habe ich nicht gesprochen! Mir eine Aussage in den Mund zu legen, die ich nicht getroffen habe und diese dann zu verneinen ist Rhetorik und ist keine Auseinandersetzung mit dem Inhalt meiner Frage.
Die These hinter meiner Frage, dass der globale Süden in der Berichterstattung zu kurz kommt, sollte unkontrovers sein. Ich frage mich, warum sie das nicht ist? Meine Frage zielt darauf ab, dass die Menschen, die unter den Folgen der Klimakatastrophe jetzt schon am meisten leiden – und das sind Menschen aus den am meisten in Mitleidenschaft gezogenen Gebieten im globalen Süden – keine Stimme gegeben wird. Diese Menschen, ihre sich rapide verschlechternden Lebensbedingungen und damit auch die Folgen unseres Handelns, bleiben so für uns unsichtbar. Darin steckt unermessliche Ungerechtigkeit! Und die Dysfunktionalität unseres Mediensystems, dass ja eigentlich genau dieses notwendige Feedback liefern muss, wird sichtbar. Warum das so ist, führt zu einer längeren Unterhaltung. Das Standardwerk zu der Frage, wie Mainstream in der Berichterstattung entsteht, ist sicher ein guter Anfang für diese Unterhaltung: Manufacturing Consent (1988) von Noam Chomsky und Edward S. Herman.
Du triffst mit dem Thema “Entwicklungshilfe” einen Punkt, der für das Selbstwertgefühl von vielen Menschen hier bei uns eine entscheidende Rolle spielt! Die Idee lässt sich bis zur Antrittsrede von Truman zurückverfolgen. Jason Hickel beschreibt das Phänomen sehr treffend: Und “genau wie in Trumans Zeit dient Hilfe als eine Art Propaganda, die die Nehmenden als Geber erscheinen lässt und im Verborgenen hält, wie die globale Wirtschaft tatsächlich funktioniert.” Hickel führt weiter aus: “…wenn wir den Blick weiten und es [die Entwicklungshilfe] im Kontext betrachten, sehen wir, dass es [die Entwicklungshilfe] weit übertroffen wird von den finanziellen Ressourcen, die in die entgegengesetzte Richtung fließen. Es [der Diskurs über Entwicklungshilfe] verbirgt die Muster der Extraction, die aktiv die Verarmung des Globalen Südens heute verursachen und bedeutsame Entwicklung behindern.” (Jason Hickel The Divide Windmill 2017 S.25 und 29).
Replik von Andre M. Schippko:
Du fragst, warum dem Globalen Süden quasi keine Stimme in der Medienberichterstattung zukommt. Ich interpretiere “quasi keine Stimme” in dem Sinne, dass es bis auf wenige Ausnahmen keine Berichterstattung gibt.
In der Medienlandschaft existieren jedoch Sendungen, die sich ausschließlich mit anderen Ländern beschäftigen. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sind hier der Weltspiegel und das Auslandsjournal zu nennen. In der Arte-Mediathek sind zudem zahlreiche Dokumentationen zu vielfältigen Problemstellungen in der Welt verfügbar. Auch private Rundfunksender bieten spezialisierte Formate an. Die Information ist grundsätzlich verfügbar – die Frage ist vielmehr, ob diesen Themen ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wie bereits erwähnt, zeigt die hiesige Bevölkerung ein gesteigertes Interesse an Wahlen und sonstigen politischen Vorgängen außerhalb Deutschlands im Vergleich zu anderen Kulturen.
Die Buchempfehlung “Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media” halte ich zwar generell für interessant, jedoch ist sie für deine Frage nicht zielführend, da sie eine Analyse der US-amerikanischen Verhältnisse darstellt. Es überrascht nicht, dass eine Gesellschaft, die einen übermäßigen Fokus auf sich selbst besitzt, ihr Land als “The World” bezeichnet und zwischen Menschen außerhalb Amerikas und Außerirdischen häufig keine sprachliche Differenzierung findet, die Themen des Globalen Südens vernachlässigt. Auf der anderen Seite lassen sich sicherlich Parallelen zur Pressearbeit in Europa finden.
Noam Chomsky sagt in einem Interview des Public Broadcasting Service (das in der dazugehörigen Dokumentation bereits zu Beginn gezeigt wird) unmissverständlich, dass er fest daran glaubt, dass die Bevölkerung grundsätzlich in der Lage ist, Irrtümer zu erkennen – sie müssen sich jedoch darum bemühen. Ich teile diese Grundsatzüberzeugung und es unterstreicht die Notwendigkeit, Informationen und Nachrichten in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen mit niedriger Zugangsschwelle zugänglich zu machen. Nicht, weil wir inkompetent sind, sondern um sicherzustellen, dass wir im wachsenden Informationsmeer nicht verloren gehen. Darüber hinaus sollten innovative und kreative Vermittlungsmethoden gesucht werden, die Aufmerksamkeit wecken und ein tieferes Verständnis für die Welt fördern.
Antwort von Malin F. Kollat**:
Antworten auf diese Frage zu finden, die Ideen liefern, was jetzt zu tun ist, ist überlebenswichtig. Geordnet, verständlich und übersichtlich zu antworten ist in diesem Rahmen kaum möglich. Joanna Macy alleine listet in einem Kapitel in ihrem Buch “Coming back to life”, in dem sie der Frage nachgeht, 14 Unterpunkte auf. Aber in verschiedene Richtungen zu zeigen, geht vielleicht schon:
Dass sich Menschen als getrennt vom Netz des Lebens erleben, ist sicher zentral. Das emotionale Erleben von Betroffenheit und Betroffensein von der Auflösung dieses globalen Netzes, das als Rückkopplung so wichtig ist, findet einfach nicht statt. Der Umstand, dass schon sehr viel verloren ist, eine eigene “Mittäterschaft” besteht und ganz viel versäumt wurde, macht eine Auseinandersetzung für die einzelne Person umso schwieriger. Denn die damit einhergehende Scham, Schuld und Trauer werden gefürchtet und in der Folge vermieden. Die Konsequenz ist eine emotionale Paralyse. Hier beantwortet der Kongress für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie die Frage auf drei Seiten und erklärt, was das für unsere Kommunikation bedeutet.
Die Liste unserer kognitiven Verzerrungen ist Teil dieser Perspektive. Sicher spielen viele davon eine Rolle, z.B. Verlustaversion, optimismus Bias, present Bias, singel Action Bias, … Die Idee, dass die Evolution unseres Bewusstseins uns schlecht für die Bewältigung der Polykrise gerüstet hat, begegnet mir häufiger mal und sie schien mir schlüssig. Mehr und mehr stelle ich diese Idee in Frage, da es viele Beispiele von Menschengruppen gibt, denen es gelungen ist, sich als Teil des Ökosystems zu erleben und es zu erhalten und die Idee einfach zu gut in die oben beschriebenen Muster unserer Verdrängung passt.
Neben dem Bewusstsein als entscheidender Faktor könnte man auch die sozialen Arrangements betrachten, aus denen sich spieltheoretische Probleme ergeben. Soziale oder multipolare Fallen, bei denen jedem Akteur nur solche Züge zur Verfügung stehen, die das Gesamtsystem kaputt machen – gleichzeitig besteht Zugzwang, d.h. es muss sofort gehandelt werden. Die Kalküle, die militärisch, ökonomisch, allgemein machtpolitisch wirksam sind, sind auf diesem Weg zugänglich. Elinor Ostrom, in jüngerer Zeit Kate Raworth und andere zeigen, wie solche Probleme gelöst wurden und werden können.
Johan Galtung weist auch auf die enorme Stabilität hin, die sich aus der Verteilung von Interessensharmonie zwischen Zentren und Peripherien im imperialen System einstellt. Ganz konkret zum Wortlaut deiner Frage, wie ich ihn verstehe, würde ich sagen, dass soziale Kipppunkte, und so etwas versuchen wir ja anzustoßen, sich einer zeitgenauen Vorhersage entziehen. Es gibt keine Sicherheit, dass es überhaupt dazu kommt. Wir versuchen es, informiert durch Forschung und motiviert durch die sich immer klarer abzeichnende Gewissheit, dass unsere Regierung sonst nicht in adäquater Weise auf den – sich ebenso immer klarer abzeichnenden – Verlust unserer Lebensgrundlagen reagieren wird.
Erwiderung von Andre M. Schippko***:
Leider habe ich selbst keine überzeugende Antwort auf diese Frage. Ich stimme dir zu, dass schnelle Antworten von großer Bedeutung sind und direkt angegangen werden sollten.
Oft wird der Klimabewegung vorgeworfen, dass ihre Forderungen darauf abzielen, die Wirtschaftsleistung des Landes zu reduzieren, um die Klimaziele zu erreichen. Eine solche Deindustrialisierung wird fast ausschließlich mit einem Verlust von Arbeitsplätzen und Lebensqualität in Verbindung gebracht, obwohl ein schlichteres Leben viele Sorgen des Alltags nehmen könnte. Die Vorstellung, dass ein einfacheres Leben dennoch Glück, Erfüllung und vor allem mehr Zeit für das eigentliche Leben bieten kann, wird schlicht nicht wahrgenommen oder verdrängt.
Derzeit erleben wir jedoch einen Trend, der in die entgegengesetzte Richtung weist. Seit der Ankündigung und Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes hat die AfD auf Bundesebene eine beispiellose Welle der Unterstützung erfahren. Dies ist bemerkenswert, da die Partei trotz zahlreicher kontroverser Themen der letzten Jahre (die sog. Flüchtlingskrise, die Covid-Pandemie, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine) zuvor nie derart hohe Umfragewerte erzielen konnte. Diese Unterstützung scheint erst durch die Ankündigung dieses Gesetzesvorhabens entstanden zu sein und nicht auf der politischen Arbeit der Partei zu beruhen. Das Vorhaben, das grundsätzlich ehrenwerte Ziele verfolgt, wurde jedoch aufgrund seiner unrealistischen Zeitvorgaben, willkürlichen Altersgrenze und der Nichtberücksichtigung ländlicher Regionen zu Recht kritisiert. Die ursprünglichen Ziele des Gesetzesvorhabens haben gezeigt, dass die Verfasser aus Milieus stammen, die von den geplanten Maßnahmen nur geringfügig betroffen wären – insbesondere finanziell. Es ist nachvollziehbar, dass sich hier ein Gefühl einstellt, dass man von oben herab beherrscht wird.
Protestaktionen wie das Beschmieren des Grundgesetzdenkmals “Grundgesetz 49” oder des Brandenburger Tors lenken weiterhin die Aufmerksamkeit unserer Mitbürger ab. Selbst wenn das Argument, dass diese Symbole in einer lebensfeindlichen Welt an Bedeutung verlieren würden, formal korrekt sein mag, rückt in der Folge das Fehlverhalten der Aktivisten in den Fokus. Schlimmer noch: Es lässt die Grundproblematik in Vergessenheit geraten.
Einen eindeutigen Wendepunkt in der Gesellschaft wird es wahrscheinlich nicht geben, solange es kein einschneidendes Ereignis mit Alleinstellungsmerkmal in unserem alltäglichen Leben gibt. Daher sollte die radikale Klimabewegung von reinen Störaktionen, deren Kommunikation nur einseitig ist, Abstand nehmen und stattdessen Aktionen durchführen, die der breiten Öffentlichkeit die drastischen Auswirkungen des Klimawandels unmittelbar und unübersehbar vor Augen führen und gleichzeitig eine aktive Reaktion auf die Frage einfordern, warum bis jetzt der oder die Einzelne sich nicht stärker am Klimaschutz beteiligt.
Replik von Malin F. Kollat:
Ich möchte mal kurz innehalten bei unserer gemeinsamen Feststellung, dass wir bei der Frage keine einfachen Antworten und dann natürlich keine einfachen Lösungen sehen.
Lass mal einen Moment gemeinsam in uns hinein schauen und ganz ruhig abwarten, was da für Emotionen in uns aufsteigen, wenn wir uns klar machen was wir da gerade festgestellt haben: Wir können nicht sehen, wie wir die Voraussetzungen für unser Leben in Planbarkeit, Sicherheit und damit auch in Freiheit, erhalten können. Mich erschüttert das immer wieder aufs Neue, wenn ich mir all das emotional vergegenwärtige – das an mich heran lasse: Da ist Verzweiflung, Angst, ein Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit und ja, auch Wut. Lange war da auch ein ganz schlimmes Gefühl von Isolation und Einsamkeit, an dem ich sehr gelitten habe – und natürlich auch Trauer. Auch ein Gefühl von einer Art existenziellen, kosmischen Obdachlosigkeit.
Das ist erst etwas besser geworden, als ich Menschen gefunden habe, die ebenfalls bereit waren, da hinzusehen. Weg ist das Gefühl natürlich nicht, wie sollte es auch, die Situation ist ja auch nicht grundsätzlich anders. Ich denke deshalb, dass es zentral und notwendig ist, sich immer wieder Zeit zu nehmen da hinzuspüren. Wir müssen das richtig erleben, was da vor uns liegt, um unser Leben an der Wirklichkeit auszurichten. Woran sollen wir uns auch sonst ausrichten?
Ich denke an den Willen, sich in eine Krise zu begeben. Allein das braucht schon Mut!
Die US-amerikanische Psychoanalytikerin Donna M. Orange spricht in ihrem Buch ”Climat Crisis, Psychoanalysis and Radical Ethics” von einer “unwillingness to be traumatised”, einem Unwillen traumatisiert zu werden. Ich denke an die kantische Erklärung der Aufklärung und, dass die Unmündigkeit selbstverschuldet ist, wenn es an dem mangelnden Entschluss und dem Mut liegt, sich des eigenen Verstandes ohne die Leitung eines anderen zu bedienen. Nietzsche höre ich auch etwas in der Richtung sagen: ”(…) sich von Eicheln und Gras der Erkenntnis nähren und um der Wahrheit willen an der Seele Hunger leiden?” Ich sehe da eine lange Unterhaltung über Würde, Ethik und den Willen, sich selbst nichts in die eigene Tasche zu lügen.
Zu deinen Gedanken zur AfD möchte ich Folgendes erwidern: Das Erstarken der Rechten ist eine weltweite Dynamik und die von dir wiederholte Darstellung weniger eine Erklärung als ein Versatzstück aus den von mir schon in Frage 3 erwähnten Verzögerungsdiskursen. Ich möchte daran erinnern, dass die Gesetzesvorlage von einer Partei, deren Wähler*innen nach der neuen Mitte Studie zu 15,9% ein rechtsextremes Weltbild haben und deren Abgeordnete in einschlägigen Klimawandelleugnungsnetzwerken vernetzt sind, wie sich z.B. hier in diesem langen Artkel detailliert nachvollziehen lässt, an die Presse durchgestochen wurde. Veröffentlicht wurde es wiederum von dem Medium, dessen Vorstandsvorsitzender, Mathias Döpfner, durchaus als Klimawandelleugner bezeichnet werden kann, und die FDP in der Bild “hochschreiben” lässt.
Was wir beobachten konnten war, wie fossiles Kapital erfolgreich darum kämpft, gegen grünes Kapital seine Vorherrschaft zu behalten. Diese Fakten sind mal so eine Andeutung der Strukturen, die da wirksam sind. Der erwähnte Artikel ist gewissermaßen Pflichtlektüre für alle, die über den öffentlichen Diskurs über den Protest gegen den Verfassungsbruch unserer Regierung ernsthaft nachdenken wollen. Ein anderer Artikel ist auf Deutsch und ebenso lesenswert zu dem Thema. Die von dir vorgebrachten Argumente gegen disruptiven Protest sehe ich vor diesem Hintergrund. Vor allem aber sehe ich, dass du dich demgegenüber sperrst, was die entsprechenden Wissenschaftler:innen zum Thema Protestformen sagen. Ich bin in Frage 4 darauf eingegangen und bin irritiert, dass du als Wissenschaftler daraufhin deine Meinung nicht zu ändern vermagst. In Frage 5 war das ähnlich.
Bemerkung vom ana magazin
Malin F. Kollat und Rene M. Schippko haben an diesem Punkt der Diskussion signalisiert, dass für ihr Empfinden die Argumente vollständig erschöpft und ein weiterer Austausch nicht zielführend sei. Bei beiden hat sich das Gefühl eingestellt, die jeweils andere Person argumentativ nicht mehr erreichen zu können. Sie konstatieren einen Zustand, der das gemeinsame Finden von Kompromissen und Lösungen unmöglich macht.
PERSPEKTIVWECHSEL | Klimakrise endet daher an dieser Stelle mit einer abschließenden Frage vom ana magazin. Malin F. Kollat und Rene M. Schippko beantworten diese Frage – anders als die vorangegangenen Fragen – unabhängig voneinander. Ein Austausch der beiden zu der Frage ist nicht erfolgt. Ein Erwidern auf die Antwort des anderen findet ebenso wenig statt.
Antwort von Rene M. Schippko***:
Die Auseinandersetzung mit der Klimabewegung zeigt eine Gruppe von Aktivisten, die oft über umfassende Bildung und ausreichend Fachkenntnisse verfügen, um wissenschaftlich fundierte Meinungen zu vertreten. Ihre beeindruckende Fähigkeit zur klaren und wirkungsvollen Rhetorik ist entscheidend für den erfolgreichen Transport ihrer Standpunkte. Allerdings fällt auf, dass die Diskussion häufig in Detailfragen abgleitet, besonders im Kontext von Begrifflichkeiten. Dies führt zu gegenseitigen Vorwürfen und lenkt den Fokus weg von der ursprünglichen Fragestellung.
Das hier geführte Streitgespräch spiegelt in gewisser Weise den gesellschaftlichen Diskurs zu zum Thema ‚Klimakrise‘ im Kleinen wider. Die zentrale Frage nach der Existenz, den Ursachen und den Folgen des Klimawandels war von Anfang an unstrittig. Der zentrale Punkt lag, ähnlich wie in unserer Gesellschaft, auf den Konsequenzen unseres Handelns und den notwendigen Veränderungen, die wir alle bewerkstelligen müssen. In der Folge erkenne ich zwei Lager, deren Anliegen in vielen Aspekten vereinbar sind, jedoch durch inakzeptable Vorgehensweisen unvereinbar erscheinen.
Beide Seiten sind hier gefordert, ihre bisherigen Überzeugungen zu überdenken, proaktiv nach einem Kompromiss zu suchen und Verständnis für ihr Gegenüber aufzubringen. Wichtig ist dabei, sich nicht von Informationskampagnen, die es von beiden Seiten gibt, blenden zu lassen und zu vergessen, was man zu wissen geglaubt hat, um Platz für die Erkenntnis zu schaffen.
Die radikale Klimabewegung hat im Kern recht. Dennoch agiert sie teilweise außerhalb der Regeln einer geordneten demokratischen Auseinandersetzung. Die freie Meinungsäußerung ist zwar ein essenzieller Bestandteil einer funktionierenden Demokratie, und ziviler Ungehorsam kann Teil eines Meinungskampfes sein, jedoch erfüllt die teils radikale Vorgehensweise nicht die Merkmale einer vollständigen Demokratie, weshalb ich sie ablehne. Auch die Tendenz, andere Meinungen von oben herab zu beurteilen, schadet letztendlich der globalen Klimabewegung und richtet mehr Schaden an, als dass sie Erfolge erzielt.
Es gibt bereits erste Ansätze der Bewegung, ihre Protestform weiterzuentwickeln, hin zu mehr Akzeptanz der Bevölkerung. Dieser Ansatz zielt weniger darauf ab, die Allgemeinheit zu stören, sondern vielmehr darauf, eine große Mehrheit hinter sich zu versammeln. Sollte dieser Weg weitergegangen werden, sehe ich eine realistische Chance, beide Fraktionen zusammenzuführen und für eine gerechtere Welt zu kämpfen.
Antwort von Malin F. Kollat**:
Ich werde eine Antwort auf die folgende Frage geben: Was möchtest du abschließend in diesem Format sagen?
Antworten auf die vom ana magazin gestellten Fragen können Sie, verehrte Lesende, leicht aus meiner Antwort herauslesen, und betrachten Sie bitte den Bruch des Formats, den ich gerade begehe, indem ich Sie direkt anspreche und mir die Freiheit nehme selbst zu entscheiden, was ich hier am Ende sagen möchte, als kleinen rebellischen Akt, der Ihnen als inspirierendes Beispiel dienen soll, für das was es jetzt und in Zukunft von Ihnen braucht ;).
Andre, du hast mir in unserem Arbeitspapier auf meine letzte Frage, warum du glaubst, besser über Protestforschung Bescheid zu wissen als die Protestforschenden selbst, mit zwei Scheinargumenten aus der Wissenschaftleugnung (ich werfe dir nicht Klimaleugnung vor!) geantwortet. Das habe ich dir erklärt und mit einer von vielen Quellen, die man dazu direkt findet, mit Substanz unterfüttert. Darauf hast du nicht reagiert und auf die vier DIN A 4 Seiten, die ich als Kommentar unter unseren letzten Austausch geschrieben habe, hast du auch in keiner Weise reagiert.
Ich muss mir das deshalb selbst erklären. Du äußerst dich hierzu auch nach freundlicher Nachfrage nicht: In unserer ersten Übungsfrage habe ich dich gefragt, ob du schon einmal eine emotionale Krise hattest, die durch Nachrichten über den Kollaps unserer Lebensgrundlage ausgelöst wurde. Du hast das verneint und mir dann erklärt warum nicht. Deine Antwort folgte dabei einem lange bekannten Muster: In dem Buch ‚Requiem for a Species‘ des australischen Philosophen Clive Hamilton (es ist als pdf-Dokument leicht zu finden) gibt es das Kapitel “Many forms of denial”, in dem einige Grundhaltungen beschrieben werden. Allesamt maladaptive Strategien, mit denen Menschen auf die enorme emotionale Belastung reagieren, die alleine von der gedanklichen Auseinandersetzung mit dem Kollaps unserer lebenserhaltenden Systeme ausgeht.
Du reagierst, wie schon vor einigen Monaten gesagt, so wie es auf Seite 128 beschrieben ist: Dadurch, dass du dich mental entziehst. Es ist eine Intellektualisierung, indem du einen Betrachtungspunkt wählst, der außerhalb des Geschehens irgendwo im Weltraum in der Ewigkeit liegt, zu dem “die Schreie der Sterbenden nicht vordringen”.
Du hast dich dazu nicht geäußert. Das Folgende mag in diesem Kontext eventuell etwas hart klingen, aber es ist genauso allgemein gemeint, wie ich es formuliere. Es handelt sich generell neben der politischen Ökonomie der Medien, die ich ebenfalls versucht habe hier einzubringen, um eine weitere entscheidende, den Diskurs prägende Dimension: Aktive Verdrängungsmechanismen sind eine desaströse Voraussetzung für eine Unterhaltung über genau die Inhalte, die verdrängt werden. Offenheit, Neu- und Wissbegierde, aber auch Einsichtsfähigkeit in Argumente sind entsprechend eingeschränkt.
Die Pressemitteilung des deutschen Kongresses für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, die ich im Rahmen von Frage 6 erwähnt habe, spricht auf den Seiten 2 und 3 sehr erhellend von der Rolle, die Verdrängung in unserer Gesellschaft spielt. Es mag für einige lohnend sein, die acht Seiten von Fabian Chmielewski zu dem Thema aus Sicht der Existenziellen Psychotherapie zu lesen. Auch die Betrachtungsweise als eine ständig laufende Traumatisierung ist eine wertvolle, die Handlungsrichtungen aufzeigt.
Viele erratische Stellen in deiner Kommunikation kann ich nur vor diesem Hintergrund einordnen.
Damit sind wir an einer Stelle gelandet, an der Unterhaltungen immer mal wieder landen. Wenn eine Seite der anderen sagt, dass sie etwas nicht versteht, weil sie unterbewusste Abwehrmechanismen hat, dann kann die so adressierte Seite nur auf zwei Weisen reagieren. Sie verneint die unterbewussten Abwehrreaktionen oder sie verneint das, was es zu verstehen gilt. In beiden Fällen wird die Person, die die Behauptung aufstellt, dass unterbewusste Prozesse am Werk sind, in ihrer Ansicht bestätigt.
Man kann das mit dem Bild der Zwickmühle beschreiben: Auch die Verneinung der Aussage bestätigt die Aussage. Einmal an dieser Stelle angelangt, gibt es argumentativ kein Vorankommen mehr. Und vielleicht empfindest du die gleiche Struktur bei mir. Es kann sein, dass eine Unterhaltung an so einer Stelle endet. Wichtig ist, denke ich, nie vorschnell zu psychologisieren, sondern mit Lauterkeit in der eigenen Absicht Diskursregeln zu befolgen und mit aller gebotenen intellektuellen Redlichkeit so lange im Gespräch zu bleiben bis hinreichend Sicherheit besteht, dass es wirklich nicht um die Argumente oder zugrunde liegende Tatsachen an sich geht.
Natürlich gibt es viel, was hier von mir gesagt wurde. Ich konnte all das mit großem Vertrauen in die Richtigkeit meiner Darstellung tun, da ich nichts anderes sage als die UN und großen Menschenrechts-organisationen, ebenso wie Papst Franziskus oder Institutionen wie Noam Chomsky.
So wie es nötig ist, sich diese Zwickmühle in der argumentativen Auseinandersetzung mit ihren Hintergründen anzusehen, um zu verstehen was geschieht, so ist es nötig, sich die Zwickmühlen anzusehen, die sich dadurch ergeben, dass die Tragfähigkeit weltweit überschritten wurde. Auch an dieser Stelle hier ist es nötig, sich die Hintergründe anzusehen. Es sind auch hier keine Probleme, für die Lösungen existieren. Es sind Zwickmühlen, für die es mehr oder weniger weise Möglichkeiten des Umgangs gibt.
Ich hoffe sehr, dass die Beiträge hier für Sie, sehr verehrte Lesende ;), eine Bereicherung waren. Es ist jetzt an der Zeit, Abschied zu nehmen – voneinander und von der vertrauten Welt der Selbstverständlichkeiten.

*Ausnahme stellt lediglich Frage 1 dar – als Frage, die zum Einstieg von der Redaktion des ana magazins an beide Diskutanten gerichtet ist. Sie soll zu Beginn der Diskussion eine Einordnung ermöglichen: Wie stehen die Diskutanten zur Klimakrise und dem aktuellen Geschehen?
** Malin F. Kollat ist ein Pseudonym. Der richtige Name und die dahinter stehende Person sind der Redaktion bekannt. Malin F. Kollat ist in der Klimabewegung zuhause und setzt sich seit Jahren persönlich und auf unterschiedlichen Ebenen für die Bekämpfung der Klimakrise ein.
*** Andre M. Schippko ist ein Pseudonym. Der richtige Name und die dahinter stehende Person sind der Redaktion bekannt. Andre Schippko promoviert in der Teilchenphysik. Er erkennt den Menschen gemachten Klimawandel an, sieht aber die Mittel der Klimabewegung im Kampf gegen den Klimawandel teils kritisch.